
Der Kampf mit dem Wertlosen
Lyrische Meditationen
1. Auflage, Juli 1992
Taschenbuch, 380 Seiten
ISBN 978-3-906347-11-7
CHF 20.00 / € 18,00
Für Bestellungen aus der Schweiz: govinda.ch
Für Bestellungen aus allen anderen Ländern: meerstern.de
— Friedrich von Schlegel (1800)
Die Schätze des Ostens sind uns mittlerweile genauso zugänglich wie die des Altertums. Doch bis heute ist aus dieser Quelle kaum geschöpft worden, obwohl sie für jeden Bereich des Lebens faszinierende, ja revolutionäre Dimensionen eröffnet.
Armin Risis Gedichtband Der Kampf mit dem Wertlosen ist eine Rückbesinnung auf diese ursprünglichen Quellen und Werte und beweist in ihrem Licht, daß der Mensch heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, in einer Wert-losen Existenz gefangen ist.
Wer sich die Zeit nimmt, auf die lyrischen Meditationen dieses Buches einzugehen, wird in sich selbst den Grenzen dieser Gefangenschaft begegnen. Denn: „Erst wenn sich ein Gefangener befreien will, merkt er, daß er gefangen ist.“
Der Kampf mit dem Wertlosen ist eine Aufforderung zu dieser Befreiung, formuliert mit geistreicher Sprache, tiefem Gedankengang und erstaunlicher Vielseitigkeit des Stiles. Eine einzigartige „indische“ Lektüre, die den Leser herausfordert und herkömmliche Werte hinterfragt.
Der Held (Antike Formen und Reimgedichte)
Gelobtes Land (Hymnische Dichtungen)
Der Kampf mit dem Wertlosen (Epigramme und andere metrische Kleinformen)
Summa metrica (Germanistische Notizen)
Anhang (Bemerkung bezüglich Inhalt, Stil und Titel der Gedichte)
Einleitung
Die vorliegende Sammlung von Gedichten verstehe ich als ein literarisches Werk und nicht so sehr als ein philosophisches oder religiöses. Sie soll also eine abwechslungsreiche Lektüre bieten, die das ästhetische Gefühl und das auf lyrischen Klang gestimmte Ohr zufriedenstellt sowie stellenweise den Leser herausfordert, ihm einen Spiegel vorhält oder eigene Gedankengänge auslöst.
Gleichzeitig jedoch wird der Leser schnell erkennen, dass ein devotionaler, philosophischer und religiöser Geist all meine Verse durchatmet, denn dies entspricht meiner Grundhaltung, die ich nun, nach dem Durchlaufen von vielen Leben im Kreis der Wiedergeburten, entwickelt habe. Deshalb möchte ich als Einleitung näher auf diese Grundhaltung eingehen, um gewisse Zusatzinformationen, die mir für die Lektüre wichtig erscheinen, zu vermitteln, aber einfach auch, um Missverständnissen vorzubeugen.
Missverständnisse könnten tatsächlich auftreten, denn die Bereiche, in denen ich mich bewege und wohl fühle, gehören heute zu den verkümmertsten, nämlich Philosophie und Religion (im Sinn der universalen und ältesten Definition, so wie sie in den Veden#fn:1 zu finden ist). Die erste Frage, auf die ich eingehen möchte, lautet deshalb: „Was ist Philosophie?“ Und dies schließt in der Konsequenz auch die Frage mit ein: „Was ist Religion?“
Philosophie ist heute weitgehend verkümmert und – direkt oder indirekt – atheistisch vereinnahmt. Dies sehen wir daran, dass entscheidende Inhalte weitgehend ausgeblendet werden, ja gewisse Begriffe und Fragestellungen sind heute praktisch tabu. Ich denke hier an die Begriffe „absolut“ und „absolute Wahrheit“. Viele, die meisten (Sie auch?), zucken zusammen: „Nein, nicht wieder! Genau das haben wir überwunden! Es gibt nichts Absolutes, zumindest kann niemand behaupten, das Absolute oder die absolute Wahrheit zu kennen.“ Und wenn jemand diese Worte verwendet und darüber diskutieren will, wird er sogleich des Sektierertums und des Fanatismus’ bezichtigt – weil die Kritiker hier auf einen einfachen, aber verhängnisvollen Denkfehler hereinfallen.
Der Denkfehler besteht darin, dass die Aussage „Es gibt nichts Absolutes“ in sich selbst eine absolute Aussage darstellt und eine absolute Wahrheit postuliert, in diesem Fall, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Die entscheidende Frage lautet also nicht: „Gibt es eine absolute Wahrheit?“, sondern: „Was ist die absolute Wahrheit?“ Es gibt auf jeden Fall eine absolute Wahrheit, und es wäre die vorrangigste Aufgabe der Philosophen, herauszufinden, worin diese besteht, oder dies zumindest zu diskutieren.
Individuell wird sich jeder Mensch während irgendeiner Phase seines Lebens diese Fragen stellen, dann aber in seiner Umgebung leider kaum Resonanz oder Antwort finden. Was mich betrifft, so fand ich Antwort (und auch die Fragestellung) erst in der vedischen Philosophie und im Kreis jener, die danach leben. Diese Erweiterung des Bewusstseins um den Aspekt des Absoluten hat mich nachhaltig geprägt und hat auch die entscheidende Inspiration ausgelöst, die meine Schreibtätigkeit erneuerte. „Der Kampf mit dem Wertlosen“ ist eine der Früchte hiervon. „Wertlos“ ist aus spiritueller Sicht alles, was nicht mit dem Absoluten in Verbindung steht, denn in Wirklichkeit ist alles Relative mit dem Absoluten verbunden. Die Frage ist nur, ob wir uns dessen bewusst sind und entsprechend leben. „Absolut“ heißt nicht absolutistisch, diktatorisch, besserwisserisch oder alleinseligmachend, sondern ist ein rein philosophischer Begriff, abgeleitet von lat. absolutum (wörtl. „losgelöst“). Absolut bedeutet: „das, was von allem Relativen losgelöst ist“, mit anderen Worten: „das, zu dem alles Relative in Beziehung steht“, „das, von dem alles Relative abhängig ist“. Das Relative, d. h. alles Vergängliche, kann einen wahren Wert bekommen, wenn es mit dem Absoluten in Verbindung gebracht wird.
Die Herstellung dieser Verbindung wird im Sanskrit yoga genannt. Yoga heißt wörtlich „Verbindung“. In der Notwendigkeit, das Relative mit dem Absoluten zu verbinden, treffen sich Philosophie, yoga und Religion, denn Religion, vom lateinischen Wort religio, bedeutet ebenfalls „Verbindung“ bzw. „Wiederverbindung (mit Gott)“. Auf dieser Verbindung und in der Bemühung um entsprechende praktische Realisation und Meditation (Ausrichtung des Geistes auf diese Verbindung) beruhen all meine Gedichte und sind somit ein lyrischer Ausdruck dieser spirituell-ganzheitlichen Grundhaltung. Daher der Untertitel „Lyrische Meditationen“.
Im höheren Sinn sind Philosophie und Religion also identisch. Zu dieser Einsicht führt uns die Lehre der Veden. Vedische Philosophie/Religion ist theistisch („monotheistisch“). Ich bezeichnete sie eingangs auch als universal, und zwar deshalb, weil sie keine konfessionellen Grenzen schafft, sondern jedem Menschen die Möglichkeit bietet, Schritte auf der Treppe des Fortschritts zu tun, egal, auf welcher Stufe sich der oder die Betreffende befindet. Selbst bei den untersten Stufen existieren nächsthöhere Stufen, und auch diese werden in den Veden beschrieben.
Die Sprache des Sanskrit und auch die vedische Philosophie haben verschiedenste Erscheinungsformen, die im isolierten Vergleich stellenweise widersprüchlich erscheinen könnten. Diese Unterschiede in der Sprache und in der Theologie sind auf die Verschiedenheit des Publikums, an das sich die jeweiligen Textstellen richten, zurückzuführen und nicht etwa auf einen widersprüchlichen Charakter der Veden, wie oft behauptet wird.
Jeder Stufe auf dieser Fortschrittstreppe sind ganz bestimmte vedische Schriften zugeordnet, mit ihren spezifischen Lehren und Unterweisungen für die Menschen auf der jeweiligen Stufe. Die Veden beschreiben in ihrer Ganzheit also einen sukzessiven Pfad des spirituellen Fortschrittes bis hin zur höchsten Stufe, der Stufe der Gotteserkenntnis. Hier trifft man die zentralen Werke des vedischen Theismus, insbesondere die Bhagavad-gītā und das Śrīmad-Bhāgavatam (aber auch andere Schriften und Lehren, z. B. die ursprünglichen Lehren Jesu). Auf diese Schriften und Inspirationen stütze ich mich in meinem persönlichen Leben und auch in meinen Gedichten.
Eine religiöse Ausrichtung in der beschriebenen Form führt nicht zu einem stereotypen oder dogmatischen Gedankengebäude, denn das Streben zu den höheren Stufen schließt die unteren nicht aus, sondern rückt sie bloß ins richtige Licht. Alle Stufen sind relativ zum Absoluten. Wer dies erkennt, hat den eigentlichen Wert der jeweiligen Stufe (Lebensphase) erkannt – und auch deren Wertlosigkeit, wenn man sich nicht von ihr löst und zu den nächsten Stufen vordringt. Das ist oft nicht so leicht, sondern ist ein Kampf, ein „Kampf mit dem Wertlosen“.
Je mehr man sich der höchsten Stufe nähert, desto breiter wird der eigene Horizont, dank der Vielzahl der Stufen, die man bereits überblickt, und der Klarheit über die nächsten. Die Erkenntnis Gottes, oder Kṛṣṇas, wie Er im Sanskrit genannt wird, ist die höchste Stufe, aber nicht die letzte, denn mit der Hinwendung zu Kṛṣṇa beginnt erst die wahre Spiritualität. Hinwendung ist der Anfang, Hingabe (bhakti) das Ziel.
Kṛṣṇa, das absolute Wesen (Gott), […] „hat“ zu allem in der Schöpfung und zu allen Individuen eine gleich-zeitige, ewige Beziehung. Sobald man sich diesem allgegenwärtigen Wesen (Sein) zuwendet, beginnt man, diese ewige wechselseitige Beziehung bewusst zu erfahren, und man möchte sie nicht wieder verlieren. Doch immer wieder werden wir vom „Wertlosen“ beeinflusst, abgelenkt, verlockt. Und so beginnen diejenigen, die erkennen, was tatsächlich Wert hat, den „Kampf mit dem Wertlosen“.
Die Seiten des Buches, das Sie nun, liebe Leserin, lieber Leser, in Ihren Händen halten, fassen meine persönlichen Erfahrungen in diesem „Kampf“ in Worte. Ich hoffe, dass Sie in der einen oder anderen Textstelle auch eigene Gefühle und Anliegen formuliert finden. Gewiss sind auch Ihnen Erfahrungen im Streben nach dem Absoluten nicht unbekannt, selbst wenn Sie dieses Absolute, „Losgelöste“, Ursprüngliche nicht Gott oder Kṛṣṇa nennen. Aber wir alle fühlen, dass wir vom Gleichen sprechen, jenem Unergründlichen, das sich uns vielfältig, oft überraschend offenbaren kann. Da meine Gedichte aus solchen Inspirationen gewachsen sind, möchte ich abschließend das Thema „Offenbarung, Inspiration und Gotteserkenntnis“ aufgreifen, um es aus dem Bereich des Vagen in einen konkreten philosophischen Zusammenhang zu stellen.
Kṛṣṇa, wie ich Gott von nun an gemäß meinem vedischen Vorbild nenne, hat eine unbegrenzte Anzahl unbegrenzter Aspekte, von denen wir eine begrenzte Anzahl begrenzt verstehen können. Mit anderen Worten, Kṛṣṇa ist nicht nur unverständlich und unfassbar, da Ihm sonst etwas fehlen würde, nämlich der Aspekt des Verständlichseins und der Zugänglichkeit. Kṛṣṇa muss also auch mit Logik erfassbar sein, persönlich zugänglich, in unseren Dimensionen erkennbar: Man muss Ihn fühlen, verstehen, hören, berühren, sehen, ja sogar riechen und schmecken können – sonst wäre Er nicht vollständig.
Unser Bewusstsein ist im bedingten Zustand auf vier Dimensionen (die drei Dimensionen des Raumes und die Zeit als vierte Dimension) beschränkt, aber Kṛṣṇa kann von der ernsthaft suchenden Seele auch innerhalb dieser vier Dimensionen erkannt werden:
In vier Dimensionen (Raum und Zeit), das heißt in der von uns erfassbaren Geschichte, erschien Kṛṣṇa vor fünftausend Jahren in Vṛndāvana (im heutigen Indien), um für hundertfünfundzwanzig Jahre auf unserem Planeten gegenwärtig zu sein, und offenbarte unter anderem die Bhagavad-gītā („Der Gesang Gottes“). Er erschien auch vor fünfhundert Jahren, diesmal in der verborgenen Inkarnation als Gottgeweihter namens Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, um zu zeigen, was die Lehren der Bhagavad-gītā für die heutige Zeit bedeuten. Innerhalb der uns nicht mehr zugänglichen Geschichte des Universums seit dessen Schöpfung ist Kṛṣṇa auch in unzähligen anderen Inkarnationen (Avatāra-Formen) erschienen, von denen die wichtigsten im Śrīmad-Bhāgavatam beschrieben werden. Zu den vierdimensionalen Erscheinungen Gottes gehören auch die Gottgeweihten, das heißt diejenigen Menschen, die ihr gesamtes relatives Leben und Streben dem Dienste des Absoluten geweiht haben.
Dreidimensional erscheint Gott in Form der arcā-vigraha (Bildgestalt) im Tempel sowie in Form aller Dinge, die Ihm geweiht werden und durch die Er Sich für unsere Sinneswahrnehmung manifestiert, zum Beispiel das geweihte Essen (prasādam), wodurch man Gott sogar schmecken, riechen und berühren kann. Diese Form Gottes sollte nicht unterschätzt werden, denn durch solches prasādam ist Kṛṣṇa schon im Leben vieler Menschen erschienen – auch in meinem. Meine ersten bewussten Kontakte mit Kṛṣṇa hatte ich im Jahr 1980 in Luzern, wo die Kṛṣṇa-Geweihten gratis solche prasādam-Speisen verteilten, und 1977, als ich eine andere wichtige Form Kṛṣṇas antraf: ein Buch über Kṛṣṇa.
Das geschriebene Wort ist Kṛṣṇas Form in zwei Dimensionen, und dazu gehört auch Seine authentische Abbildung. Durch jede Form strahlt Kṛṣṇas spirituelle Allmacht, so auch durch Seine zweidimensionale Erscheinung. Wenn wir näher betrachten, welche Veränderungen ausgelöst wurden, seit Kṛṣṇas gedrucktes Wort weltweit verbreitet wird (erst seit rund zwanzig Jahren [ich schrieb dies 1992]), erkennen wir, dass es keine Übertreibung ist, wenn die Veden die Bhagavad-gītā und das Śrīmad-Bhāgavatam als die „Schriftinkarnationen“ Gottes bezeichnen und voraussagen, dass das Erscheinen Kṛṣṇas in der zweidimensionalen Form eine spirituelle Revolution im Herzen der Menschen auslösen werde.
Ähnliches kann über die eindimensionale Form Gottes gesagt werden. Wie Śrī Caitanya offenbart hat, ist dieser eindimensionale Aspekt im gegenwärtigen Zeitalter am wirkungsvollsten, da er uns das bewusste Verständnis aller anderen Aspekte Gottes vermittelt: Klang, die heiligen Namen Gottes (von denen die direkten Namen, wie Kṛṣṇa und Rāma, in den vedischen Schriften besonders hervorgehoben werden).
Religion und Philosophie sind heute sehr verkümmert, weil sie voneinander getrennt worden sind. Die Philosophie forscht nicht mehr nach der absoluten Wahrheit, sondern vertrocknet im Relativen, und die Religionen können Gott nicht mehr philosophisch und deshalb auch nicht mehr praktisch vermitteln, weshalb sie entweder weltlich und oberflächlich oder dann dogmatisch-fanatisch geworden sind. Welche Religion oder Philosophie kann Gott ein-, zwei-, drei-, vier- und multidimensional (immanent und transzendent) erklären und vermitteln? Aber die Aufgabe der „Disziplinen“ Religion und Philosophie wäre genau diese Vermittlung und Verbindung (religio, yoga), und in der Erfüllung dieser Aufgabe liegt deren Wert oder Wertlosigkeit.
Wenn man nun dank göttlicher Verbindung erkennt, was wertlos ist, führt dies nicht zu einer körperverteufelnden oder weltfremden Haltung, sondern vielmehr zu einer praktischen, Kṛṣṇa-bewussten Welteinsicht, wodurch man lernt, alles Relative, d. h. jeden Gegenstand und auch sich selbst, den eigenen Körper, die eigenen Gefühle, Gedanken und Wünsche, gemäß dem ursprünglichen Zweck aktiv zu verwenden, nämlich in Verbindung mit dem Absoluten. Man muss sich also nicht so sehr vom Materiellen trennen als vielmehr von der Unwissenheit, die uns an das Materielle und Vergängliche bindet.
So bin ich nun dabei, eine Kṛṣṇa-bewusste Welteinsicht zu entwickeln und zu lernen, auch im Relativen, Alltäglichen, scheinbar Unbedeutenden den ewigen (absoluten) Wert zu entdecken. Und nach vielen Reinkarnationen komme ich zum Punkt, wo ich mit mir ehrlich bin und vor dem Kampf mit dem Wertlosen nicht mehr zurückschrecke und ihn auch nicht mehr verdränge. Zeugnis hiervon sind meine Gedichte, die ich zu meiner eigenen Läuterung verfasste, aber auch mit der Hoffnung, dass auch andere, die mit dem Wertlosen „kämpfen“, aus ihnen spirituelle Inspiration schöpfen mögen. Nur aus diesem Grund wage ich, meine Manuskripte zu veröffentlichen. […]
— A. R., im März 1992
Armin Risi (1999 / 2024):
Erläuterung zur Form meiner Gedichte
(aus: Armin Risi, „Ausgewählte Gedichte. Bemerkung zur Form meiner Gedichte“ in: Einblicke – Eine Auswahl aus zehn Jahren Govinda-Verlag, herausgegeben von Ronald Zürrer, 1999; im Februar 2024 leicht bearbeitet und erweitert.)
Die Versformen, die ich in meinen Gedichtbänden verwende, entstammen der Tradition der griechischen und romanischen Lyrik. „Lyrik“ bedeutet wörtlich „das mit Lyra-Begleitung Vorgetragene“. Der lyrische Dichter verstand sich ursprünglich als Sänger, der göttliche Wahrheiten hörbar und erfahrbar vermittelt. Die lyrischen Dichterinnen und Dichter trugen und spielten ihr Instrument, die Lyra, weil sie sich selbst als Instrumente sahen, als Instrumente im Dienst der göttlichen Ordnung, die den Kosmos beseelt.
Der Dichter, der „Sänger“, nimmt die im Kosmos rhythmisch schwingende Ordnung wahr und antwortet mit einer ent-sprechenden Sprache. Sprache ist der Ausdruck von Inhalt, der göttlich oder weniger göttlich sein kann. Aber Sprache an sich ist immer Klang, und Klang ist Ausdruck von Ordnung (auch im physikalischen Sinn in Form von Wellenstrukturen). Ordnung ist letztlich immer Ausdruck der göttlichen Bestimmung der Schöpfung. Auf diese Weise lässt sich ein direkter Bezug von Sprache zu Ordnung und göttlicher Bestimmung erkennen.
Die lyrische Dichtung steht der Musik nahe, denn auch sie verwendet Rhythmen, das heißt eine geordnete Abfolge von Klängen, durch die die Dichtenden bewusst auf die göttliche Ordnung und Bestimmung der Schöpfung hinzuweisen und ihrem persönlichen Streben, Leiden, Scheitern, Suchen und Erkennen Ausdruck zu verleihen. Der Rhythmus ist nichts anderes als Ausdruck der bereits überall in der Schöpfung wirkenden Ordnung.
Durch die Einordnung der Sprache in eine geordnete Struktur wollten die lyrischen Dichterinnen und Dichter ursprünglich ihre göttliche Gesinnung veranschaulichen: ihre Bereitschaft, sich freiwillig in die göttliche Ordnung einzufügen (was für sie im praktischen Leben nicht immer leicht war und was der Lyrik das Tor zu unbegrenzt vielen Themen öffnet). Der Rhythmus lud zum gesungenen oder melodiös intonierten Vortrag ein und intendierte eine Läuterung der Vortragenden wie auch der Zuhörenden, wodurch sich die „Aktiven“ und „Passiven“ in einer dynamischen Einheit befanden (im Gegensatz zum modernen Kommerzgespann von „Unterhalter“ und „Konsumenten“).
Die Versschemen bilden also die äußere Form der Sprache für einen ent-sprechenden Inhalt und Vortrag. In der romanischen Tradition wurde vor allem das Reimgedicht verwendet, mit dem Sonett als Sonderform, und auch ich bediene mich gern solcher Formen. Etwas ungewohnter für den modernen Leser sind die griechischen Versmaße, die sich nur über rhythmische Muster definieren und keine Reime erfordern. Das bekannteste griechische Versmaß ist der Hexameter (von: hexámetron, wörtl. „Sechs-Maß“). Ein Hexameter ist eine Zeile, die vom Grundmuster her aus sechs Daktylen bestehen. Ein Daktylus (Betonung auf dem a: Dáktylus) ist ein Versfuß mit drei Silben, wobei die erste betont und die zwei folgenden unbetont sind, wie zum Beispiel bei: singende; unsere; kam aus der; alle Be-(Rufenen), usw.
Im deutschen Hexameter brauchen die ersten vier Versfüße nicht allesamt reine Daktylen zu sein. Vorgegeben ist, dass die erste Silbe des Versfußes immer betont ist, aber danach ist es jeweils frei, ob zwei unbetonte Silben oder nur eine folgen. Fest ist, dass der fünfte Versfuß ein reiner Daktylus sein muss, und der sechste ist immer verkürzt, also nur eine betonte Silbe gefolgt von einer unbetonten. (Der sechste und letzte Versfuß der Zeile endet nie mit zwei unbetonten Silben, sondern immer nur mit einer.)
Graphisch wird dies wie folgt dargestellt:
—◡(◡)ˌ—◡(◡)ˌ—◡(◡)ˌ—◡(◡)ˌ—◡◡ˌ—◡
Eine besondere Form des griechischen Versmaßes ist das Distichon („Zweizeiler“), das aus einer Hexameter-Zeile und aus einer Pentameter-Zeile besteht. Pentameter (betont auf dem a: Pentá meter) bedeutet „Fünf-Maß“. Er übernimmt die ersten zweieinhalb Einheiten des Hexameter und spiegelt sie, so dass sich in der Mitte der Zeile zwei betonte Silben berühren. Der Einschnitt zwischen den zwei betonten Silben (bei der Spiegelachse) wird Zäsur genannt. In der Hälfte vor der Zäsur können die ersten zwei Daktylen eine oder zwei betonte Silben enthalten. In der zweiten Hälfte dürfen nur vollständige Daktylen folgen.
—◡(◡)ˌ—◡(◡)ˌ— || —◡◡ˌ—◡◡ˌ—
Ein Beispiel aus Friedrich Hölderlins elegischem Gedicht Brot und Wein:
Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott.
—◡ˌ—◡◡ˌ— || —◡◡ˌ—◡◡ˌ—
Die reimlose Doppelzeile des Distichon wird oft für kurze, zweizeilige Sinnsprüche, Weisheiten oder auch für sarkastische Polemiken verwendet. Diesbezüglich bekannt sind die „Xenien“, die Schiller und Goethe zum Teil gemeinsam schrieben.
Aus dem Deutschunterricht kennen viele diesen Merkspruch von Friedrich Schiller:
Das Distichon
Im Hexameter steigt des Springquells flüssige Säule,
Im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab.
Ebenfalls von Friedrich Schiller, hier mit etwas zynischem Inhalt:
An die Muse
Was ich ohne dich wäre, ich weiß es nicht; aber mir grauet,
Seh’ ich, was ohne dich Hundert’ und Tausende sind.
Zwei Beispiele von mir, die auch in den Auszügen aus Der Kampf mit dem Wertlosen – Lyrische Meditationen aufgeführt sind:
Das Distichon
Der Hexameter gießt den Gedanken in klarknappen Wortlaut,
Und des Pentameters Spitz’ schärft den Gedanken zum Guss.
Versfluss
So natürlich und leicht kann ein Distichon klingen und fließen,
Dass ein Laie darin gar nicht ein Versmaß bemerkt.
Ein Distichon kann also allein für sich als Zweizeiler stehen. Werden mehrere Distichen aneinander gereiht, entsteht durch diese Wiederholung die Gedichtform des „elegischen Distichon“, kurz auch einfach „Elegie“ genannt. All diese Formen finden sich auch in meinen „lyrischen Meditationen“.
Diesbezüglich bahnbrechend in der deutschen Literatur waren:
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 – 1803)
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Friedrich Schiller (1759 – 1806)
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843)
Kurze „Kostproben“
Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung,
Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet,
Und durch die er Adams Geschlecht die Liebe der Gottheit
Mit dem Blute des heiligen Bundes von neuem geschenkt hat.
— Klopstock: Der Messias, Erster Gesang (1749), Zeilen 1 – 4
Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen! es grünten und blühten
Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken
Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel;
Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen,
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.
— Goethe: Reineke Fuchs (1794), Zeilen 1 – 5
Welches Wunder begibt sich? Wir flehten um trinkbare Quellen,
Erde! dich an und was sendet dein Schoß uns herauf?
Lebt es im Abgrund auch? Wohnt unter der Lava verborgen
Noch ein neues Geschlecht? Kehrt das entfloh’ne zurück?
Griechen! Römer! O kommt! O seht, das alte Pompeji
Findet sich wieder, aufs neu bauet sich Herkules Stadt.
— Schiller: Pompeji und Herkulaneum (1797), Zeilen 1 – 6
Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter,
Aber über dem Haupt droben in anderer Welt.
Endlos wirken sie da und scheinen’s wenig zu achten,
Ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns.
Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen,
Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.
[…] Indessen dünket mir öfters
Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein,
So zu harren, und was zu tun indes und zu sagen,
Weiß ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit?
Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester,
Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.
— Hölderlin: Brot und Wein (1800), Strophe 7
Die letzten zwei Zeilen beziehen sich auf den Mythos des Bacchus (Dionysos). Hölderlin erkannte aus intuitiver Erinnerung die kulturgeschichtliche Relevanz dieses Mythos und nahm mehrfach Bezug darauf, insbesondere in der ersten Strophe des Gedichts Dichterberuf:
Des Ganges Ufer hörten des Freudengotts
Triumph, als allerobernd vom Indus her
Der junge Bacchus kam, mit heilgem
Weine vom Schlafe die Völker weckend.
(Hölderlin war der erste westliche Dichter, der die Namen Ganges und Indus – und Indien – in Gedichten erwähnte.)
Vorbemerkungen zum Titel, Inhalt und Stil (1992)
[Diese Texte fügte ich 1992 als Anhang zum Gedichtband Der Kampf mit dem Wertlosen ein. Für die vorliegende Wiedergabe habe ich sie gekürzt und stellenweise überarbeitet.]
I.
Dem Titel „Der Kampf mit dem Wertlosen“ liegt der Sanskritbegriff anartha-nivṛtti #fn:2 zugrunde, mit dem eine Stufe des Fortschritts auf dem Pfad des bhakti-yoga bezeichnet wird. Auf der Stufe des anartha-nivṛtti („Sichlösen von wertlosen Anhaftungen“) erlangt man im Licht des Bewusstseins über das höchste Ziel eine differenzierte spirituelle Sicht auf die eigenen nächsten Schritte und Ziele.
Wenn nach finsterer Nacht die Sonne aufgeht, erkennt man gleichzeitig die Sonne, sich selbst und seine Umgebung. Ebenso lichten sich auf der Stufe des anartha-nivṛtti die Wolken der materiellen Fehlvorstellungen, man erkennt den spirituellen Sinn des Lebens und bemüht sich, von den bindenden Einflüssen der materiellen Welt freizuwerden und dieses nun bekannte Ziel zu erreichen. Diese innere Entwicklung, das Erkennen des Zieles und das oft hindernisreiche Streben danach bilden den Inhalt der spirituell inspirierten Lyrik.
II.
Die verschiedenen Epochen der deutschen Literaturgeschichte haben ein großes Erbe hinterlassen, dessen Einfluss weit über die Grenzen des deutschen Sprachraumes hinausreicht. Im Laufe der Zeit sind im Deutschen viele klassische Vers- und Strophenformen entstanden, die sich zu einem großen Teil an antiken oder romanischen Vorbildern orientieren und ursprünglich für erhabene Inhalte reserviert waren. „Der Kampf mit dem Wertlosen“ ist ein Versuch, bewusst das altindische Gedankengut in diesen traditionellen Sprach- und Versformen auszudrücken, ein Versuch, der gezwungenermaßen experimentellen Charakter haben muss.
Angesichts des Einflusses, den literarische Werke haben können (und hatten), wird es offensichtlich, wie notwendig es ist, dass gerade im Bereich der Kultur (Dichtung, Dramaturgie, Musik, Kunst usw.) spirituelle Einflüsse konkrete Form bekommen. Die vedische Hochkultur hatte in all diesen Bereichen eine erstaunliche Perfektion erreicht, und deshalb sind die Schätze dieser Kultur eine wahre „Goldmine“ für neue Ideen und Perspektiven.
III.
Die deutsche Sprache in lyrischer Diktion und klassischer Form besitzt einen eigentümlichen Klang, der dem modernen Leser fremd oder veraltet erscheinen mag. Aber diese dichterische Ausdrucksweise hat mannigfache Vorzüge, einer zum Beispiel, dass die Konzentration und eigenständige Denkkraft sowie die sprachliche Feinfühligkeit (des Lesers und des Schreibers!) gefordert und gefördert werden.
Die poetische, „nicht-prosaische“ Sprache spielt mit der ständig ringenden Verbindung von Form und Inhalt, wobei die Form manchmal bis zu einem gewissen Grad den Inhalt bedingt (wie im elegischen Distichon) und der Inhalt manchmal die Form durchbricht (wie bei den eigenrhythmischen Hymnen).
Die vorliegenden Gedichte lassen sich im weiten Sinne in die Kategorie der „Gedankenlyrik“ einordnen. Die Sprache dieser Art von Lyrik ermöglicht und erlaubt es, eine vielschichtige, in der Prosa ungewohnte Ausdrucksweise zu verwenden, wodurch die Aussage durch nuancenreiche Andeutungen oft sehr ausgeweitet werden kann. Dabei ist es jedoch wichtig zu wissen, dass das „Ich“ in meinen Gedichten ein „poetisches Ich“ ist und nicht notwendigerweise ein autobiographisches.
IV.
Eine Richtlinie, der ich mich gerne „verschreibe“, ist das Metrum (Versmaß). Die Verwendung von Metren und als Folge davon das Ringen um Harmonie zwischen Metrum, Worten und Inhalt werfen viele poetologische Fragen auf, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Eine Richtlinie möchte ich dennoch erwähnen, so wie ich sie für mich formulierte: „Der Lyriker soll sich an die Regeln der gewählten Formen halten, so dass ihm die Regel auch die Möglichkeit der Ausnahme bietet.“ (Sonst ist die Ausnahme keine Ausnahme mehr, sondern Willkür oder einfach ein Fehler. Die Möglichkeit der Ausnahme setzt natürlich voraus, dass derjenige, der schreibt, die Regeln kennt.)
Wenn ich eine Versform wähle, halte ich mich also an die Regeln und übergehe auch Details nicht, erlaube mir aber an gewissen Stellen (praktisch als Lohn für die sonstige Treue) auch seltene Ausnahmen. So bietet sich ein zusätzliches inhaltliches Stilmittel an, nämlich das versteckte Hervorheben einer Aussage, denn ich löse das Recht zur Ausnahme nur dort ein, wo eine prägnante Formulierung nicht bloß des Versschemas wegen verloren gehen soll. (Versteckt ist die Hervorhebung deshalb, weil sie nur derjenige erkennt, dem die metrische Abweichung auffällt.)
Versschemen mögen in der Theorie sehr monoton und mechanisch aussehen. In der Praxis jedoch erkennt man, dass dem nicht so ist, insbesondere wenn man das Wesen der deutschen Prosodie (Betonungslehre) betrachtet: Nicht jede betonte Silbe muss im Versschema mit der Thesis (Hebung) zusammenfallen. Wenn eine betonte Silbe einer noch stärkeren folgt, kann sie innerhalb des Versfußes auch zur Arsis (Senkung) werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die antiken Versmaße. So schrieb zum Beispiel das Sprachgenie August Wilhelm von Schlegel (1767 – 1845) diesbezüglich:
„Die Art unserer [der deutschen] prosodischen Bestimmung: Die wenigsten Längen und Kürzen sind bei uns absolut; die meisten relativ, nach ihrer Stellung. Sie werden gegen die vorhergehende und nachfolgende Silbe abgewogen und gelten für kurz, wenn sie nur leichter sind als diese, für lang, wenn schwerer.“ (in: „Betrachtungen über Metrik“, 1798)
In den nachfolgenden Beispielen erscheinen die Wörter „über“, „staunt die“, „werden“. Alle sind auf der ersten Silbe betont, aber innerhalb eines Daktylus können sie auch zwei Senkungen füllen:
Jeder Vers über Gott ist erleuchtend, drum wag’ ich zu schreiben.
Wenn Alexander staunt, staunt die Welt, und in Indien staunt ein
Welterfahrner sogar [...]
Wunsch und Verdienst werden eins, wenn man sich Kṛṣṇas Dienst wünscht.
(In diesem Pentameter füllen die einsilbigen Wörter „man“ und „Dienst“ ebenfalls Senkungen.)
V.
Die vedischen Schriften erklären, dass śabda-brahma die Ur-Sache und die Grundform unserer Erscheinungswelt ist. Śabda bedeutet „Klang“ im Sinn von „Schwingung“ („Information“), die einen spirituellen Ursprung (brahma) hat. Auch andere Quellen unterschiedlichster Ausrichtung erwähnen eine solche Erklärung, z. B. das Johannes-Evangelium („Am Anfang war das Wort“) oder die fortgeschrittene Physik, die sich heute ebenfalls dieser Erkenntnis nähert, nämlich dass die Materie in ihrer Grundform als Schwingung (śabda) existiert und auf andere Dimensionen hinweist, die sich dem Zugriff der empirischen Forschung entziehen.
Das Feinste in den uns sensorisch wahrnehmbaren Dimensionen ist „Schwingung“. Deshalb wird Klangschwingung auch die „symbolische Repräsentation eines Gegenstandes“ genannt, denn Worte und Namen haben die Kraft, in unserem Bewusstsein konkrete Bilder, Gedanken, Gefühle und Wünsche wach werden zu lassen. Diese Analyse zeigt, wie mächtig Klang und Wort, insbesondere mantras, Gedichte und Musik, sein können, da sie als feinster grobstofflich-materieller Ausdruck direkt an der Grenze zu den höheren Sphären stehen und deshalb unser Bewusstsein stark beeinflussen können, zum Guten oder zum Schlechten.
Musik und Dichtung wie Sprache und Klang im allgemeinen folgen ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die Bemühung nun, diese Gesetzmäßigkeiten sichtbar, hörbar oder lesbar werden zu lassen, setzt unausgesprochen voraus, dass eine solche Ordnung bereits inhärent in der Sprache, in der Klangschwingung (und demnach in der gesamten Schöpfung), vorhanden sein muss. Ordnung ist das ursprüngliche Prinzip und kann nicht vom Geschaffenen selbst erzeugt worden sein, da diese Ordnung ja Vorbedingung für die Entstehung des Geschaffenen war. Mit anderen Worten, jede Bemühung, Ordnung zu finden und auszudrücken, ist direkt oder indirekt der Versuch, die Hand des Schöpfers hinter der Schöpfung zu erkennen. Klang und insbesondere Dichtung und Musik sind deshalb in ihrer Urform universal-theistisch.
Aufgabe des Dichters ist es, diese reine Klangschwingung aus dem seichten, Wert-losen Geplätscher des weltlichen oder pseudoreligiösen Durchschnittes herauszuheben und sie einem entsprechenden Publikum zugänglich zu machen. Der Dichter muss Seher (poeta vates), Lehrer und gleichzeitig auch sich bemühender Schüler sein.
Dieses Selbstverständnis des „Dichterberufs“ (Beruf … Berufung) wurde als Ideal schon öfters zum Ausdruck gebracht, insbesondere in den klassischen Epochen, und als Maßstab für den Wert einer Dichtung angelegt:
„Kampf mit dem Wertlosen“
(anartha-nivṛtti: wörtl. „vom Wert-losen lossagen, loskommen“)
Denn das Wirkliche ist Ganzheit und Urgrund zugleich.
Ganzheit ist ewig gleich zeitlos – und zeitlos wirklich und gültig.
Ganzheit als Urquell erzeugt Urschöpfung, Leben und dich.
Nullordnung (Chaos) und Kosmos sind Pole der göttlichen Schöpfung,
Ausdruck des Ewigen, drum ursprünglich wahr, gut und schön.
Dass sich im Wahren, Guten und Schönen das Göttliche spiegelt,
Ist nicht Illusion, sondern reale Vision.
Dies sind die wahrlichen Werte, alles andre ist wertlos,
Leer, trist, getrennt von Gott. Gegenteil dann ist der Fall.
Echte Werte sind die wirklichen Ziele im Leben.
Kämpfe drum wertvoll für dich, du bist ein Gottseelenteil.
(Solches Ge-Wissen bewirkt Frieden und wahrhaftes Heil.)
→ siehe auch Bhagavad-Gīta 4.35 und 4.42
Zusatz:
Wer das Weltall ohne den geistigen Urgrund betrachtet,
Glaubt, dass die Welt an sich zufällig nichtig entstand,
Ohne Sinn, Grund und Ziel, also sinnlos, grundlos und ziellos –
Wie auch der Mensch und sein Geist, kommend vom, endend im Nichts.
Nichts habe eigenen Sinn, nicht der Kosmos und auch nicht das Leben,
Nichtig sei’n Gott und Engel und jedes höhere Streben.
Wer in Materie schläft, darf dann erwachen im Tod.
Jenseits des Stofflichen ist die tragende Wachwelt des Geistes.
Zeitloses, immer aktuell, gründet im Urquell all-ein.
Ganzheit, das Göttliche (Gott), ist der Urgrund, weshalb auch die Schöpfung
Leben und Ordnung enthält: Form und Struktur und Gesetz,
Ausdruck des ewig Präsenten, des Wahren und Guten und Schönen.
Fazit mit direktem Bezug zum Yuga-Avatāra (siehe: Und plötzlich große Klarheit):
Gehe in Resonanz
mit Caitanyas ekstatischem Tanz,
dann kommt das alles wandelnde Wunder,
und alles wird friedvoll und runder,
aber nicht täuschend rund
wie der vorherrschende Teufelskreis,
denn die göttliche Kund’
verlangt keinen Teufelspreis.
Jetzt ist die Zeit
zur Überwindung der Spaltung,
und die innere Haltung
entscheidet, wie weit
der Weg noch ist, bis nach der tragischen Pacht
die Menschheit in Heilung erwacht.
(Poetisches Comeback nach über dreißig Jahren für die Auswahl Wie Sterne am Tag;
21. Februar 2024, als ich mit Jahrgang 62 62 wurde, mit inhärenter Gotteszahl 26 – siehe: Und plötzlich große Klarheit, S. 28 und 390)
Versfluss
Anderer Gesang
Ausnahme von der Regel
Grenzfall
Gefolgschaft des Wortes
Wiederkehr
Sintflut
Meine Verweigerung
Erstmals sah der Westen Indien wieder, doch war’s ein
Auftakt nur: Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
Der Held
Wenige Menschen, o Genius, bewegten den Geist aller Zeiten,
Helden nannte man sie, Krönung des Menschengeschlechts.
Lange, bis heute, lebt ihr Ruhm und der Ruf ihres Todes,
Denn die furchtlose Kraft war ihres Muts Attribut.
Sie alle brachen das Mittelmaß, brachten selbst Gipfel zum Wachsen,
Dass man Jahrtausende später noch über sie spricht.
Doch immer seltener wurden sie, solch Koryphäen, und ihre
Höhen, unerreicht, ja einsam vergessen und nur
Noch in Büchern geehrt, entziehn sich den späteren Forschern.
Ja, deren Schatten allein lösen in ihnen schon Un-
Glauben aus. Beschränkt ward ihre Sicht durch das Dunkle,
Nur noch das Nahe sah man, sich und das eigne Geschlecht.
Frühere Leben entschwanden, wie Sonnen hinter den Bergen.
Sehend den Körper nur noch, sahn sie Geburt als Beginn.
Ja, so wurde kleiner ihr Maß, um das Große zu messen,
Und des Größeren Spur glaubten sie kleinlich nicht mehr.
Jene doch warn dem Vergangnen noch näher und spiegelten Zukunft.
Helden drum nannte man sie, Krönung des Menschengeschlechts.
Wenige solche, o Genius, bewegten den Geist aller Zeiten,
Dass man Jahrtausende später noch über sie spricht.
[Eröffnungsstrophe zum 16-strophigen elegischen Gedicht „Der Held“]
Versfluss
So natürlich und leicht kann ein Distichon klingen und fließen,
Dass ein Laie darin gar nicht ein Versmaß bemerkt.
Anderer Gesang
Bald erlischt die Quelle der Verse. Die Zeit ist vorüber.
Schweigend gewachsen zum Fluß, ström’ ich den Meeren nun zu.
Ausnahme von der Regel
Nur bei stetig gemeisterter Form ist ein Bruch überzeugend,
Wie Überschwemmung beim Nil Regel und Blüte erzeugt.
Grenzfall
Manchmal streng’ ich Grammatikprozesse an und beanspruch’
Sprache zur höchsten Instanz, bis mir der Richter diktiert.
Gefolgschaft des Wortes
Reisen bedarf’s, um Gemälde zu sehen, Konzerte zu hören;
Aber das ewige Wort folgt uns als treues Gedicht.
Wiederkehr
Wohnt nicht hier die junge Dame,
Die ich früher schon gekannt?
Ja, es ist derselbe Name,
Und es ist mein Heimatland.
Nun bin ich nach langem Wandern
Aus der Welt zurückgekehrt.
Ich, im Gegensatz zu andern,
Hab mich bis zum Schluß gewehrt.
Freunde fieln an Front und Scharten –
Nichts blieb mir im Krieg verschont.
Doch die Trennung und das Warten
Ward nun durch den Sieg belohnt.
Blut und Jahre mußten weichen,
Doch nicht jenes Angesicht.
Selbst im Kreis von feuchten Leichen
Hielt ich dieses Bild ans Licht.
Wohnt nicht hier dieselbe Dame,
Die ich vor dem Krieg gekannt?
Wo ist sie, die ich im Grame
Lange in mein Herz gebannt?
Hier der Garten, hier der Erker,
Ich erkenn mein Paradies.
Fort, Kostüm, du bist mir Kerker
Und der Siegessaal Verlies!
Selbst die ganze Welt als Beute
Wiegt nicht so wie die Person,
Deren Ferne ich bereute,
Schluchzend, Mutter, ich, dein Sohn!
Wohnt nicht hier die edle Dame?
Nun so alt wie sie wär’ ich.
Wieder ruf ich, doch ihr Name
Klingt so fern für sie und mich.
Kennt sie mich, die dort nachsinnt,
Mich, den Sohn, im leichten Kleid?
Aus dem schwangern Auge rinnt
Trän’ um Trän’ in Mutterleid.
Doch nun bin ich wieder hier –
Sei alles, wie zuvor!
Hör mich, Mutter, komm zu dir!
Es klopft an deinem Tor.
Ja, mein Krieg ist endlich aus,
Ich wachte auf im All.
Fern den Körper, wie ein Haus,
Sah ich nach dem Fall.
Andre kamen, riefen kalt
Namen von der List’.
Damals schwieg ich, und schon bald
Galt ich als vermißt.
Doch nun kam ich, endlich wahr,
Grüß dich, Elternhaus!
Kennt ihr mich noch, Trauerschar,
Alles Leid ist aus!
Grüßt mich keiner, fröstelt euch
Meine feine Hand?
Alt seid ihr, das ahnt’ ich schier,
Da die Zeit schnell schwand.
Alt ward alles, seit ich ging.
Muß ich’s nun gestehn,
Mir, der körperlosen
Heimatlosen Seel’?
Totgeglaubte Seele,
Wie kamst du hierher
In diesen Mutterschoß
Sintflut
1
Vor Cäsar damals hinzutreten,
Hättest du’s gewagt?
Vor ihm die Wahrheit zu vertreten,
Hättest du’s gesagt?
„O Herr, ich sah schon viele Reiche,
Jedes kam und fiel.
Auch deinem Reich geschieht das gleiche,
Zeit fehlt nicht mehr viel!“
2
Bestimmt wär’ Cäsar bei solch Worten
Sehr in Wut entbrannt.
Doch was blieb heut’ von seinen Orten?
Nur noch Schutt und Sand.
Bestimmt fällt’s schwer zu akzeptieren,
Was ein andrer sagt,
Doch was als Mensch würd’ man verlieren,
Wenn man Höh’res fragt?
3
Drum frag ich jetzt: Ist es nicht wahr,
Sind wir nicht alle wie Cäsar?
Kleine Cäsars, zugegeben,
Sind wir nur in unsrem Leben;
Doch käm’ ein Fremdling, uns zu sagen,
Was wir täten, sei vergebens,
Würden wir’s mit Fassung tragen,
Diesen Schreck des Lebens?
4
Und doch auch droht des Cäsars Ende
Unsrem kleinen Reich.
Noch jeder starb mit jäher Wende –
Schicksals letzter Streich.
Drum werd nicht zornig bei der Mahnung
Vor der nahen Not!
Sei dankbar ob der Wahrheit Ahnung,
Die uns dient als Boot!
5
Was hast im Meer du zu verlieren,
Wo dir nichts gehört?
Willst du die Wellen denn verzieren,
Wo man dich beschwört:
Besteig das Boot und kehr nach innen,
Hülle ist stets tot!
Verlieren nie und nur gewinnen
Wirst du auf dem Boot.
Meine Verweigerung
(Echnaton-Fragmente)
Entengleich folgen sie mir, die plötzlichen Freunde der Jugend.
Niedere Günstlinge rief leider ich in meinen Kreis.
Alle lügen und heucheln, selbst Könige, menschenunwürdig.
Reichtum wollen sie nur, lichtlos bereit für den Krieg.
Früher fuhrn sie mit hängenden Feinden als Zeichen den Nil hoch.
Deutete keiner das Bild, um das Verhängnis zu sehn?
Gottesdienst will ich vom Staat nicht trennen und fördere jenen.
Lieber verlier ich mein Reich als meine Treue zu Gott.
Ehrlichkeit, Macht und Erfolg sind in heutiger Zeit selten Brüder.
Seltsam ist’s: Eine Welt liegt uns zu Füßen, und doch
Murret das Volk. Das Erbe der Vorfahrn, durch Kriege erlangt, scheint
Nicht zu genügen, und mehr Beutegold fordert die Lust.
Aber wie Sand gibt es Gold in Ägypten, so schreiben mir Fürsten.
Weshalb sucht dann das Volk ferne bei ihnen nach Gold?
Unsere Bauten sind dünn und jene der Toten gewaltig,
Bleibt der Erfolg uns versagt, nur weil die Bürger nicht sehn?
Blinde folgen willfährig und wollen nun wieder zum alten,
Längst Überwundnen zurück. Aber noch hab ich die Macht,
Einziger Sohn meines Vaters, als Thronfolger lange ersehnter,
Frucht meiner Eltern Gebet, ja einer ganzen Nation.
Nun hat mir Aton, Seinem Geweihten, die Welt übergeben.
Deshalb gelte mein Kampf göttlicher Ordnung und Glück.
Aber ein Krieger war ich nie – dem Licht will ich dienen.
Wenn solch ein Pharao weint, weinet auch Gott um die Welt.
Wo ist ein Land, ein altes, das Heimat und Freunde mir bietet?
Leider kenn ich es nicht, und auch dies Land kennt mich nicht.
Gotts Harmonie wird alles heilen, auch ohne mein Handeln.
Gut ist letztlich die Welt; nur in Verstecken herrscht Nacht.
Aber ich hab mich versteckt, und selbst wenn ich nichts unternehme,
Finden Probleme mich doch. Holt mich die Zeit wieder ein?
Jene Probleme, die sich nun stellen, nennen die andern
Strafe des rächenden Gotts, weil ich mit Götterdienst brach.
Aber ich weigre mich heute, Betrug mit Betrognen zu spielen.
Wollen die Völker nicht, will wenigstens ich Perfektion.
„Ich darf Ihnen sagen, daß mich Ihre dichterische Formulierungsgabe und metrische Fähigkeit in der deutschen Sprache sehr beeindruckt hat. Zweifellos verfügen Sie über ein beachtliches poetisches Talent, dessen Pflege für Sie Zukunft haben dürfte.“
— Prof. Dr. phil, Dr. h. c. et h. c. Stefan Sonderegger
Linguistische Abteilung, Universität Zürich
„Die literarischen Gebäude, die Sie an Ihrem geistigen Weg aufgerichtet haben, habe ich mit Respekt betrachtet und vieles davon auch mit Gewinn und innerer Zustimmung gelesen – auch wenn ich nicht verschweige, daß es zwischen dem rhetorischen Anspruch und der Stille und Bescheidenheit des geistigen Vorsatzes vielleicht eine Differenz zu bemerken gäbe, die mir freilich in Ihrem Alter auch weniger aufgefallen wäre als heute.“
— Prof. Dr. Adolf Muschg
(einer der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller der Gegenwart)
„Ihre zwei interessanten Bücher … geben Einblick in ein vielfältiges und gehaltvolles Denken in interkulturellem Zusammenhang, was heute von großer Bedeutung ist.“
— Prof. Dr. M. Stern (Deutsches Seminar, Universität Basel)
„Ich habe die Völkerwanderung gelesen und dabei Einsicht gewonnen in ein Gebiet, das mir sozusagen ganz fremd war, und dabei gestaunt über Ihr Wissen und Ihre geistige Erfahrung. Auch in den lyrischen Meditationen lese ich immer wieder gerne, und ich stimme mit Ihnen überein, wenn Sie schreiben [S. 316]:
Wenn ich seh’, was man heute im Namen von Lyrik für gut hält,
Muß ich, trotz Demut, gestehn: Meine ist gar nicht so schlecht.
Ich muß sagen, ich staune über Ihre dichterischen Fähigkeiten.“
— Dr. phil. Hans Marfurt (Rektor i. R. des Gymnasiums Reußbühl)
und ehemaliger Englischlehrer von Armin Risi
„Armin Risis Dichtungen sind mir immer wieder Herz- und Augenöffner, Horizonterweiterer. Seine Völkerwanderung hat mein vom gängigen Schulwissen geprägtes Bild der Menschheitsentwicklung und -geschichte geradezu revolutioniert und in mir tiefes Mitgefühl für unsere uralte Dramaturgie auf der Bühne der ‚Welt‘ geweckt. Und die einfühlsame sowohl poetische wie forschende Annäherung an Hölderlin hat mir nicht nur jenes Dichters wunderbare Sprache nahegebracht, sondern auch meiner eigenen, innersten Sehnsucht Worte und Flügel verliehen. Es sind kostbare Werke, wo Sprache in Verbindung mit Wissen innere und äußere Schönheit schaffen. Nachhaltig.“
— Gerda Tobler (Kunstmalerin und Yoga-Lehrerin)
Lehrbeauftragte an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich
- Veden: vom Sanskritwort veda, „Wissen“. Sammelbegriff für die heiligen Schriften der altindischen Hochkultur.
- anartha: wertlos, unnütz, schädlich; nivṛtti: Abwendung, Loslösung, Entsagung. „Der Kampf mit dem Wertlosen“ ist eine markante und provokative Übersetzung dieses wichtigen Begriffs der Yoga-Mystik.
© 1992 – 2024 Armin Risi
Home | Aktuell/Neu | Bücher | DVDs | Artikel | Biographie & Bibliographie | Veranstaltungen



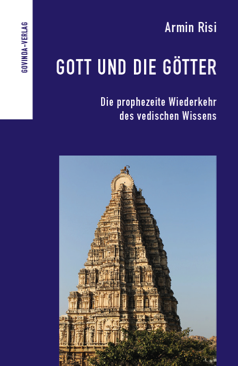


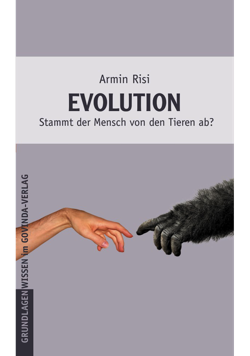
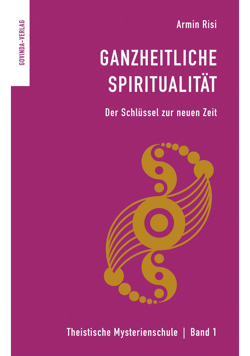
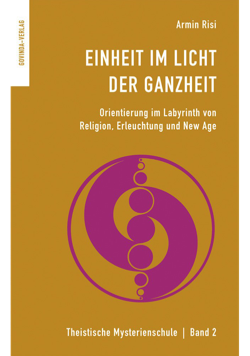



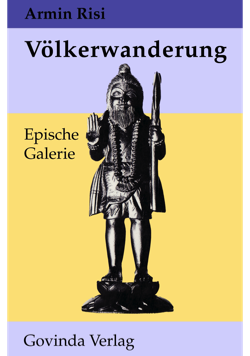





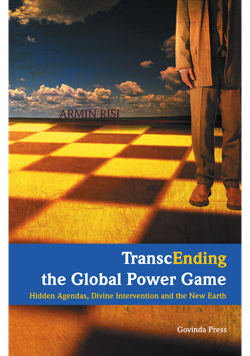

 quadratisch.jpg)